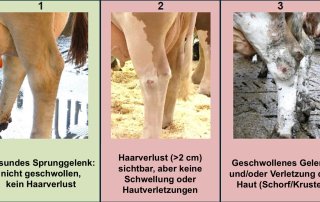Spritzen und Kanülen richtig pflegen
Die Verabreichung von verschiedensten Impfstoffen und anderen Medikamenten durch betriebseigene Fachkräfte steht in vielen tierhaltenden Betrieben auf der Tagesordnung.
Verantwortungsbewusste Tierärzte empfehlen, die verwendeten Spritzen und Kanülen nach jedem Gebrauch zu reinigen. Besonders für den Erfolg vom Impfmaßnahmen ist äußerste Sauberkeit von entscheidender Bedeutung. Unsaubere Spritzen oder Kanülen, die mit Schmutz, Blut, anderen Medikamenten oder Reinigungsmitteln kontaminiert sind, können den Tieren schaden, die Impfung unwirksam machen oder Abszesse an der Einstichstelle hervorrufen.
Grundsätzlich lassen sich hochwertige Spritzen reinigen, desinfizieren und damit gefahrlos wiederverwenden. Wenn die Spritze nicht verwendet wird, sollte sie in einem sauberen verschließbaren Plastikbeutel oder Behältnis staubfrei und trocken gelagert werden.
Spritzen sollten nach jedem Gebrauch gründlich mit heißem Wasser und einer milden Seifenlauge von außen und auch von innen gereinigt werden. Viele Spritzen lassen sich dazu zerlegen. Wenn nötig, findet eine Bürste Verwendung. Mit der Reinigung sollen Staub und Schmutzpartikel sowie die Impfstoffreste im Zylinder entfernt werden. Seifenreste sind gründlich mit klarem, warmem Wasser abzuspülen, im Anschluss müssen alle Teile vollständig trocknen.
Vor der nächsten Verwendung sollte eine Desinfektion selbstverständlich sein. Das KFM-Merkblatt „Spritzen und Kanülen richtig reinigen und desinfizieren“ gibt dazu wertvolle Hinweise.
Uwe Weddige
Foto © Shutterstock